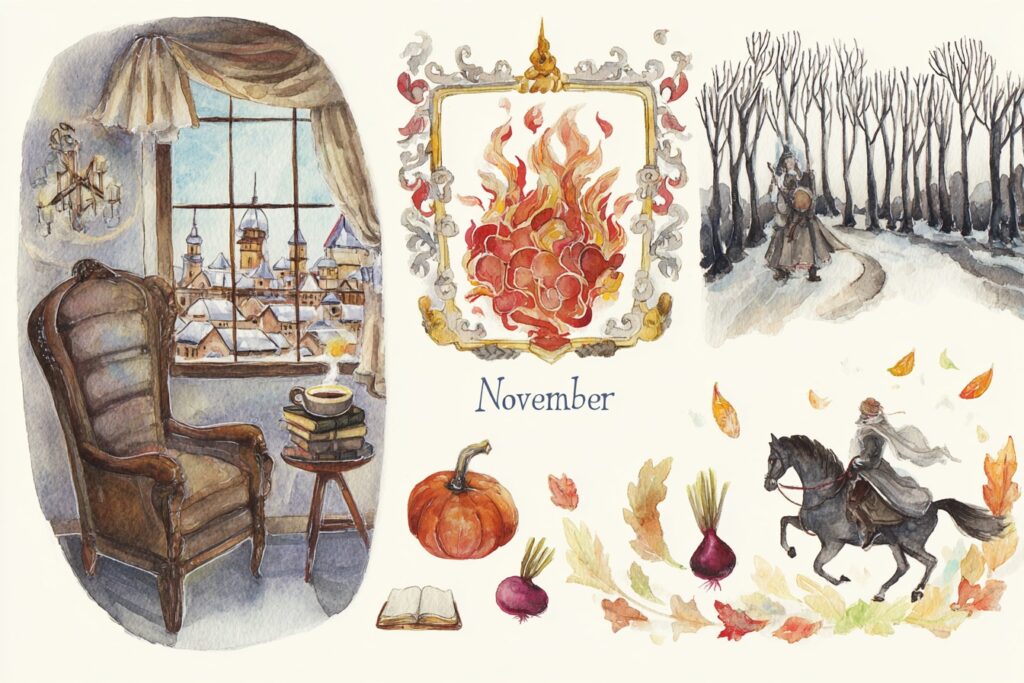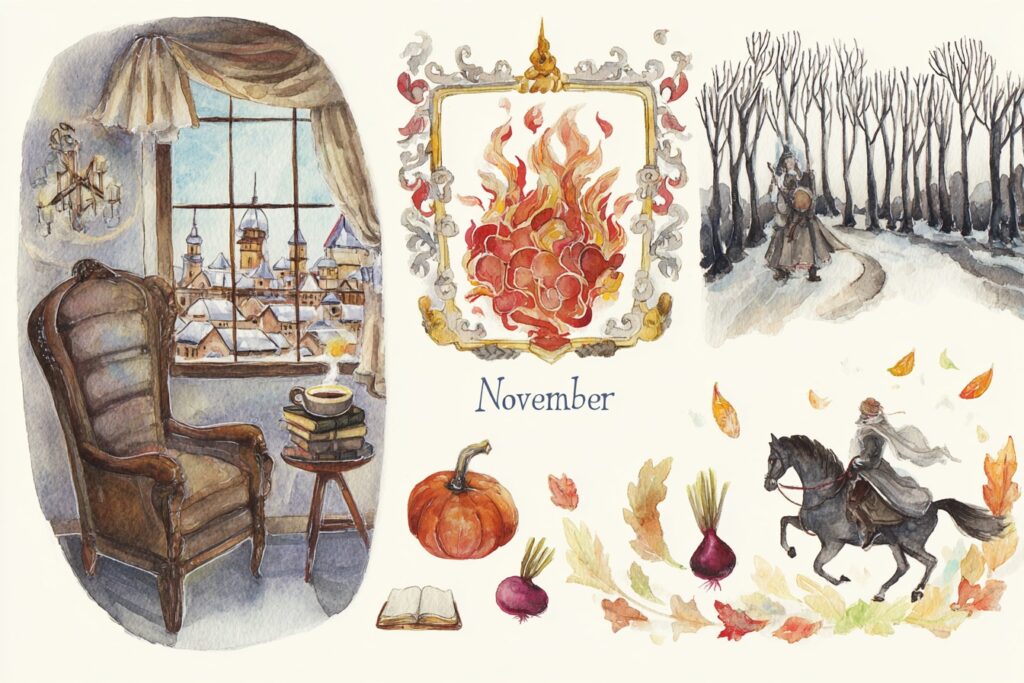Rübengeister, Rommelbòòzen, Trauliichter, Kürbisse – diese herbstlichen Lichtgestalten gehören seit Jahrhunderten zu einem ganzen Geflecht aus Bräuchen, das in unserer Region zwischen Saar, Lothringen und Luxemburg eine erstaunliche Lebendigkeit bewahrt hat.
Wer heute an Halloween denkt, hat meist grell beleuchtete Kürbisse und amerikanische Kostüme im Kopf. Doch die eigentlichen Wurzeln dieses Festes liegen viel näher – hier, in unserer Region zwischen Saar, Lothringen und Luxemburg. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum sich diese Bräuche hier mit so erstaunlicher Lebendigkeit gehalten haben
Die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November war schon in der Antike von Ritualen umgeben, die den Übergang vom alten ins neue Jahr, vom Licht in die Dunkelheit markierten. Die Kelten feierten damals Samhain – ein Schwellenfest zwischen Sommer und Winter, zwischen Leben und Tod. Aus diesen Riten entwickelte sich über viele Umwege das heutige Halloween. Doch während der keltische Ursprung oft romantisiert oder geleugnet wird, haben sich seine Spuren hier, im Herzen Europas, besonders lange gehalten.
Die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November war schon in der Antike von Ritualen umgeben, die den Übergang vom alten ins neue Jahr, vom Licht in die Dunkelheit markierten. Die Kelten feierten damals Samhain – ein Schwellenfest zwischen Sommer und Winter, zwischen Leben und Tod. Aus diesen Riten entwickelte sich über viele Umwege das heutige Halloween. Doch während der keltische Ursprung oft romantisiert oder geleugnet wird, haben sich seine Spuren hier, im Herzen Europas, besonders lange gehalten.
In Lothringen hieß das alte Fest noch bis nach dem Ersten Weltkrieg Samhain, und die ländlichen Bräuche, die sich daraus entwickelten, blieben vielerorts lebendig. Im Pays de Nied, aber auch in der Grenzregion zu Luxemburg und im Saarland, spricht man bis heute von der Rommelbootzennaat, der Nacht der Rübengeister. Kinder höhlten Futterrüben aus, schnitzten Fratzen hinein und stellten Kerzen hinein – nicht als Dekoration, sondern als Schutzzeichen. Diese Lichter galten als Symbol für Wärme, Leben und Hoffnung in der dunkler werdenden Jahreszeit.
In den luxemburgischen Ardennen, dem Ösling und der angrenzenden Eifel nannte man sie Trauliichter. Wenn das Vieh im Spätherbst von den Weiden zurück in die Ställe geführt wurde, sollten diese Lichter die Tiere und Menschen vor Krankheit und Unheil bewahren. Die Knaben schnitzten in der Dämmerung ihre Rübenlaternen, begleiteten das Vieh und erschreckten mit grinsenden Lichtern die Dorfbewohner, die von der Kirche kamen. Ein alter, bäuerlicher Lichtbrauch, der den Übergang zwischen Erntezeit und Winter auf magische Weise begleitete.
Wie genau sich dieser Brauch ausbreitete, wird sich wohl nie sicher feststellen lassen. Volkskundler wie Doldinger oder Mossiat führen die Varianten auf unterschiedliche Ursprünge zurück – mal auf Stall- und Schutzrituale, mal auf maskierte Schreckbräuche. In Altenkirchen etwa wird der Rummelbooz mit einem alpinen Männerbrauch in Verbindung gebracht, der an die „Habergeiß“ erinnert – eine dämonische Gestalt in Ziegen- oder Vogelgestalt, die im Alpenraum zwischen November und Dreikönig durch die Dörfer zog, um mit Schellen, Masken und Lärm die bösen Geister zu vertreiben. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, als viele Menschen aus dem Alpenraum in das entvölkerte Saargebiet übersiedelten, brachten sie ihre alten Bräuche mit – darunter vermutlich auch diesen. So mischten sich alpine Elemente mit den lothringisch-luxemburgischen Lichttraditionen, und daraus entstand jener typische, vielschichtige Herbstbrauch, den wir heute als Rommelbootzen- oder Rübengeisterfest kennen.
Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte der Brauch vielerorts eine Wiederbelebung. In Zeiten von Armut und Hunger zogen Kinder mit ihren Rübenlaternen von Haus zu Haus und baten um kleine Gaben – Äpfel, Gebäck oder ein paar Münzen. Manche sahen darin einen Bettelbrauch, andere eine Art Erntedank in schwerer Zeit. Belegt ist, dass besonders zwischen Allerheiligen und Weihnachten solche Lichtumzüge stattfanden – eine stille, aber eindrückliche Erinnerung daran, dass Licht und Gemeinschaft den Winter erträglicher machten.
Erst viel später kam das moderne Halloween über den Atlantik. Anfang der 1990er Jahre – ausgelöst durch die Absage des Karnevals 1991 wegen des Golfkriegs – startete die deutsche Spielwarenindustrie eine gezielte Kampagne, um Kostüme und Dekoartikel über Halloween zu vermarkten. So fand das amerikanische Fest in kurzer Zeit auch hierzulande Verbreitung. Doch wer glaubt, Halloween sei eine amerikanische Erfindung, irrt: Seine tiefsten Wurzeln liegen genau hier – zwischen Mosel, Saar und Ardennen.
Der Rübengeist ist die neuzeitliche Gestalt eines sehr alten Ahnen- und Lichtbrauchs. Sein Zauber liegt nicht in der Rübe selbst, sondern im Licht, das sie trägt – im Symbol des Lebens gegen die Dunkelheit, in der Verbindung von Mensch, Natur und Erinnerung. Vielleicht lohnt es sich, diese alte Tradition im Saar–Lor–Lux-Raum wieder stärker aufleben zu lassen. Nicht aus Nostalgie, sondern weil sie uns zeigt, dass selbst im Dunkeln immer ein Stück Wärme und Gemeinschaft leuchten kann.
Es wäre schön wenn diese Alte Tradition sich im Saar-Lor-Lux Raum wieder mehr ausbreiten würde. Und die alten Geister die wir einmal riefen bei uns blieben …